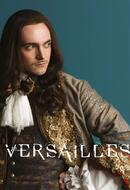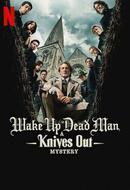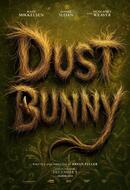In the Darkroom – Kritik
Zwischen persönlichem Drama und der Globalgeschichte des Linksextremismus: Nadav Schirman porträtiert Magdalena Kopp.

Irgendwann steht Magdalena Kopp vor einer Litfaßsäule, in Neu-Ulm, ihrer Geburtsstadt. Vor langer Zeit war sie die Ehefrau von Ilich Ramírez Sánchez, Codename Carlos, der in den 1970er und 1980er Jahren als erster Star-Terrorist die Welt in Atem hielt. Nun blickt Kopp auf ein Plakat, auf dem Olivier Assayas’ Carlos (2010) beworben wird. Sie bleibt kurz stehen, geht dann weiter.
Dieser Moment spielt nur eine sehr beiläufige Rolle in der Geschichte, die Nadav Schirmans Dokumentation In the Darkroom erzählt, er ist bloß einer von vielen, in denen Magdalana Kopp als Frau dargestellt wird, die unter ihrer Vergangenheit leidet. Assayas schilderte ihre Beziehung zu Carlos durchaus ambivalent, durchzogen von Begehren wie von Machtverhältnissen, vieles wurde offen gelassen, blieb angenehm unbestimmt. Im Interview mit Schirman nun erzählt Magdalena selbst: von ihrem Leben als Linksextreme im Untergrund, von ihrem Einstieg bei den Revolutionären Zellen, von Carlos, dem Terroristen, der sie, so legt sie es nahe, zu einer Beziehung quasi gezwungen hat. Ob Magdalena jenen Film gesehen hat, in dem sie von Nora von Waldstätten gespielt wird und in einer Szene diesen Carlos verführt, das wissen wir nicht. Und doch spuken die Bilder des Assayas-Werks im filmischen Hinterkopf herum, wenn In the Darkroom sich nun daran macht, mittels der persönlichen Sicht der Betroffenen den Anspruch auf ein genaueres Hinsehen geltend zu machen. Doch was heißt eigentlich genauer?

So genau wie ein Foto vielleicht. Während Carlos ein Film reiner Bewegung war, wie sein Protagonist ständig nach vorn preschend, getrieben von gefassten Plänen, geglaubten Revolutionen und der diplomatischen Dynamik des Kalten Krieges, steht Magdalena Kopp in einer Dunkelkammer und entwickelt Fotos. Schirman hat dieses Set aufgebaut, um Vergangenheit und Gegenwart seiner Protagonistin zu verbinden. Früher einmal wollte Magdalena Fotografin werden, nun entwickelt sie für In the Darkroom Aufnahmen aus ihrem alten Leben, das nicht mehr viel mit Fotografie zu tun hatte. Wo sich bei Assayas also alles in Dynamik auflöste, sollen wir nun innehalten, heranzoomen, die Entscheidungen Magdalenas nachvollziehen, Zeuge ihres Blicks zurück werden. Und ein wenig klingt das schon nach Rehabilitierungsversuch, diese Geschichte vom naiven Mädchen, das sich in den Wirren der Protestbewegungen verirrte, irgendwann nicht mehr zurück konnte und gefangen war im Bann des Schakals. Ihre Last scheint sie loswerden zu wollen mit diesem Interview, und das ist persönlich so verständlich wie filmisch problematisch.
Ob ihre Schilderungen nun stimmen oder nicht, an welchen Stellen sie unehrlich ist, sich selbst belügt und so weiter, das sind müßige Überlegungen. Viel wichtiger als die Frage nach der Wahrheit ist die Frage nach dem Verhältnis zur Wahrheit, die ein Filmemacher einnimmt bei seinem Rückgriff auf die Form dokumentierter Erinnerung, die nicht weniger Filter ist als das Drehbuch eines Spielfilms. Und lange Zeit scheint es so, als wäre In the Darkroom tatsächlich nur eine Bühne für Magdalena Kopp und ihre Geschichte, Autobiografie auf dem filmischen Beichtstuhl – unterbrochen nur für Ergänzungen: Ihre Schwester berichtet zwischendurch vom familiären Alltag während Magdalenas Leben im Untergrund; das ehemalige RZ-Mitglied Hans-Joachim Klein begründet seinen Ausstieg aus der Gruppe mit den zunehmenden antisemitischen Tendenzen; daneben stehen Erinnerungen an die Carlos-Hatz von Verfassungsschutzbeamten und Journalisten. Doch immer kehren wir zurück in die Dunkelkammer, zu Magdalena und ihren Erinnerungen, zum persönlichen und familiären Drama – und der historische Hintergrund ist nur noch Kuriosum.

Erst im zweiten Teil des Films schleichen sich Dissonanzen an, und die persönliche Neugier wird zu einer historischen, vermittelt ausgerechnet durch ein Familienmitglied, nämlich Magdalenas Tochter. Rosa Kopp ist mittlerweile eine junge Frau, ihren berüchtigten Vater kennt sie nur aus alten Fernsehbildern und den Erzählungen ihrer Mutter. Zusammen mit Schirman versucht sie nun, dieses Bild zu ergänzen, besucht dabei sogar den ehemaligen PFLP-Sprecher in Syrien, für den Carlos kein Terrorist, sondern ein heldenhafter Kämpfer für die palästinensische Sache ist. Sie spricht aber auch mit Klein, der ihr auf ziemlich direkte Weise deutlich macht, dass Magdalena für ihn eine Heuchlerin ist. Für Rosa vermehren sich nicht die Antworten, sondern die Fragen an ihre Mutter.

Nun ist das Motiv des Kindes, das die Wahrheit über seine Erzeuger herausfinden will, als vermeintlich neutrale Perspektive nicht weniger problematisch als die Beichte des Interviews. Doch Rosa Kopp repräsentiert schon eine interessante Verdopplung, wenn sie jene Generation nach ihrer Vergangenheit befragt, die selbst vor allem mit einer solchen Wahrheitssuche in den eigenen Familienakten assoziiert wird. Versteht man diese Verdopplung nicht als den falschen Versuch, unsinnige Vergleiche zu ziehen, sondern als notwendigen Impetus, eine ernsthafte Geschichtsschreibung der 1960er und 1970er Jahre in Gang zu bringen, mit ihren Utopien und Dogmen, ihren progressiven wie reaktionären Verrücktheiten, dann ist Rosa Kopp nicht bloß ein Teenager, der die Frage nach der eigenen Herkunft aufwirft, sondern der einer so nahen und doch so fernen Zeit auf die Schliche kommen will, der sich fragt, was da eigentlich los war. Und insofern Schirman zwar nicht genauer als Assayas, aber eben doch ein wenig anders hinsieht, ist In the Darkroom ein bescheidenes, aber doch interessantes Puzzlestück in einer noch längst nicht auserzählten Geschichte.
Neue Kritiken

Kung Fu in Rome

Dangerous Animals

Versailles

Highest 2 Lowest
Trailer zu „In the Darkroom“

Trailer ansehen (1)
Bilder




zur Galerie (7 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.