Hockney – Kritik
40 Jahre nach Jack Hazans kongenialem Künstlerporträt A Bigger Splash gibt es nun einen neuen Dokumentarfilm über David Hockney. Der strotzt nur so vor ungesehenen Aufnahmen und aktuellen Interviews, entwickelt aber keine neue Perspektive auf den Meister.

Vielleicht ist der Vergleich mit A Bigger Splash, der heute als Klassiker des Queer Cinema gilt, etwas unfair. Schließlich konzentrierte sich Hazan auf eine bestimmte Episode aus dem Leben des damals angesagtesten britischen Malers: auf die Zeit nach der Trennung von seinem ersten Lebenspartner, dem kalifornischen Modell und Künstler Peter Schlesinger. Auch verwischte Hazan gezielt die dokumentarische Form, indem er seine Figuren – Hockney und die Freunde aus der Bohème – nicht einfach distanziert in deren Alltag begleitete, sondern bewusst in das Geschehen eingriff und zahlreiche Szenen improvisieren ließ. Sein Film ist nicht nur ein Dokument von Hockneys erster großer Lebenskrise, sondern zugleich eine Repräsentation seiner Kunst: ein Spiel mit dem Darstellen und Verbergen, die Reflexion einer allgegenwärtigen Künstlichkeit.
Portrait of an Artist
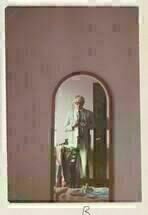
Randall Wrights neue Hockney-Dokumentation folgt einem ungleich konventionelleren Programm. Weitgehend chronologisch blättert sie das Leben des 1937 geborenen Künstlers auf: von der Kindheit in einem tristen Arbeiterviertel im nordenglischen Bradford über die wilde Studienzeit, den ersten Erfolgen als Maler im Swinging London der frühen 1960er und das ausschweifende Künstlerleben in New York und Los Angeles in den 1970er und 80er Jahren bis zur Etablierung als einer der wichtigsten bildenden Künstler des 20. Jahrhunderts. Wright erhielt für seine von der BBC in Auftrag gegebene Arbeit Zugang zu Hockneys persönlichem Archiv. Sein Film bietet so auch eine Fülle neuen Materials. Neben Skizzen und Studien bestechen vor allem die privaten Fotografien und Filmaufnahmen: Hockney beim Scrabble-Spiel mit seinen bereits greisen Eltern; Hockney beim Kuscheln mit seinem besten Freund, dem Kurator Henry Geldzahler. Zusammengehalten werden diese teils überaus intimen Einblicke durch Interviews, die Wright mit Weggefährten geführt hat, wie mit der Textildesignerin Celia Birtwell, dem Kunsthändler John Kasmin oder dem Schauspieler Jack Larson. Und natürlich kommt auch Hockney selbst zu Wort.
Hockney hat stets seine persönliche Umgebung gemalt: die Orte, an denen er gelebt hat, seine Freunde und Liebhaber. Eine biografische Lesart seines Werks scheint deswegen unumgänglich, und Wrights Vorgehen, Hockneys Lebensstationen mit dessen schier zahllosen Porträtbildern und Gemälden von kalifornischen Swimmingpools zu illustrieren, ist deshalb zunächst naheliegend. Die Assoziationen, die dieses Verfahren anbietet, wirken aber oft allzu aufdringlich und profan. Als etwa ein Interviewpartner berichtet, Hockney habe sehr unter der Enge und Tristesse seiner proletarischen Heimatstadt gelitten, zeigt Wright ein frühes Gemälde, auf dem eine verzweifelt aussehende Figur von dem sich wiederholenden Wort „help“ umringt ist. Das helle und weite Kalifornien wird in der Folge als Gegenraum zu dem dunklen und engen Bradford entworfen – eine alte und oberflächliche Lesart, die Hockney selbst mit seinen späteren, magisch leuchtenden Heimatbildern widerlegt hat.
Vanishing Points

Der Film bietet aber auch ambivalentere Einblicke, etwa in Hockneys Umgang mit der eigenen Homosexualität. Der flamboyante Künstler machte daraus nie ein Geheimnis, ja er verteidigte sie sogar immer wieder energisch gegen die Kleingeister seiner Zeit. Als ihm etwa nach seiner ersten Amerikareise die mitgebrachten Nacktmagazine vom britischen Zoll abgenommen wurden, erstritt er sich vor Gericht die Rückgabe. Amüsiert berichtet Hockney, wie ihm ein peinlich berührter Secret-Service-Beamter die Softpornos auf der Schwelle seiner Londoner Wohnung zurückbringen musste. Doch Hockney weiß die Freiheiten, die er als schwuler Mann früh genoss, richtig einzuordnen: „I lived in Bohemia, and Bohemia is a tolerant place.“ Tatsächlich war Homosexualität nie ein exponierter Gegenstand seiner Bilder, vielmehr hat sie in seiner Kunst stets etwas Selbstverständliches – und wird gerade dadurch politisch: Das schwule Künstlerpaar Christopher Isherwood und Don Bachardy porträtierte Hockney ebenso als eigenständige Pole einer innigen Lebensgemeinschaft wie die heterosexuellen Eheleute Celia Birtwell und Ossie Clark.
Doch in Wrights Film klaffen auch große Lücken. Nur sehr kurz behandelt er etwa die für Hockney zentrale Episode mit Peter Schlesinger. Und auch die zweite große Lebenskrise des Malers erfährt nur flüchtige Beleuchtung: Hockney, der Freundschaften einmal als den einzigen roten Faden bezeichnet hat, der sich durch sein Leben ziehen würde, verliert in den 1980er und 90er Jahren fast seinen kompletten Freundeskreis an AIDS. Der Künstler selbst analysiert kühl, die Folgen der Krankheit kämen dem Tod der US-Bohème gleich: „It changed New York more than anything else.“ Wie aber schlägt sich diese radikale Verlusterfahrung in Hockneys Kunst nieder? Mit diffizilen Fragen dieser Art kann sich Wright in seiner Tour de Force durch ein turbulentes, über 75-jähriges Künstlerleben nicht aufhalten.
Ways of Looking

Der große Porträtmaler Hockney wird in dem ausfransenden Porträtfilm als klassischer Künstler gezeichnet, der sich mehr für die Kunst, Literatur und Musik des 19. Jahrhunderts interessiert als für die Konzeptkunst der Postmoderne. Hockney besitzt aber auch die durchaus postmoderne Fähigkeit, sich immer wieder neue Formen und Formate für seinen künstlerischen Ausdruck zu erschließen, etwa als Designer von Bühnenbildern für die Oper, und sich auf technische Entwicklung einzustellen, wie mit seinen iPhone- und iPad-Bildern. Was das Geheimnis seiner Kunst sei, wird Hockney gefragt. Ihm gehe es immer darum, erklärt dieser, neue und seinem Betrachter zuvor nicht für möglich gehaltene Blickperspektiven zu eröffnen, denn: „New ways of seeing mean new ways of feeling.“ Derart grenzüberschreitende Wahrnehmungen thematisieren viele seiner größten Arbeiten, wie etwa das mysteriöse Poolbild „A Bigger Splash“ oder die großformatigen Polaroid-Collagen, mit denen Hockney die fotografische Illusion von angehaltener Zeit dekonstruiert.
„Wider perspectives are needed now!“ – Letztlich scheitert Wright gerade an dieser zentralen Hockney-Prämisse. Dem bildungshaften Anspruch, die Künstlerpersönlichkeit nahezu allumfassend abzubilden, fällt die Möglichkeit eines neuen Blicks zum Opfer. Hockney ist eine ausführliche, stellenweise aufschlussreiche Sammlung von Archivmaterial, aber er ist kein bigger splash.
Neue Kritiken

No Other Choice

Ungeduld des Herzens

Melania

Primate
Trailer zu „Hockney“


Trailer ansehen (2)
Bilder




zur Galerie (5 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.











