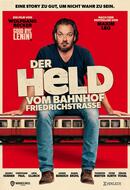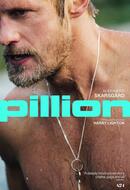Die Vermissten – Kritik
The Kids aren’t all right: In Jan Speckenbachs verunglücktem Drama entwickelt sich der Generationenkonflikt zwischen Eltern und Kindern zum endzeitlichen Kampf.

Mit dem Ende der Kindheit geht zumeist der „Verlust der Unschuld“ einher. Was sich zunächst speziell auf die ersten sexuellen Erfahrungen bezieht, ist tatsächlich eher Ausdruck einer fast universellen Auffassung vom Kind als moralisch unschuldigem Wesen. Nicht wenige Horrorfilme funktionieren über den Widerspruch zwischen eben jener kindlichen Reinheit und einer mit ihr kombinierten, Genre-typischen Bösartigkeit. Jan Speckenbachs Drama Die Vermissten (2012) beinhaltet zwar einige mysteriöse Anklänge und apokalyptische Bilder, nimmt sich des Themas jedoch aus einer gezielt unspektakulären Autorenfilm-Perspektive an.
Nach dem Verschwinden mehrerer Kinder beginnt der Ingenieur Lothar (André Hennicke) auf der Suche nach seiner Tochter in eine kindliche Geheimgesellschaft vorzudringen, die sich seinem Verständnis fundamental verweigert. In den verlassenen Straßen des ländlichen Niedersachsens marodieren verwahrloste Kinder – sie plündern Häuser, zerstören die von ihren Eltern errichteten Gebäude und plädieren dafür, Menschen im Alter von 60 Jahren kontrolliert umzubringen. In Die Vermissten ist der unvermeidliche Generationenkonflikt zum endzeitlichen Kampf ausgeartet. Erwachsene rotten sich zu Bürgerwehren zusammen und kämpfen gemeinsam um ihr Überleben. Die Kinder rebellieren zum Teil durch gewalttätige Aufmüpfigkeit, vor allem aber entziehen sie sich der Welt der Erwachsenen vollständig und üben mit der Errichtung ihrer ganz eigenen Welt radikale Zivilisationskritik.

Diese Ausgangssituation klingt vielversprechend, lädt sie doch sowohl zu einer Neuinterpretation des Mythos vom unschuldigen Kind ein als auch zu einer Reflexion über den spätestens während der Pubertät aufklaffenden, oft unüberbrückbaren Graben zwischen Eltern und Kindern. All das (und mehr) zu wollen, ist jedoch eines der zentralen Probleme von Die Vermissten. Speckenbach überlädt den Film ebenso hemmungs- wie hoffnungslos. Ob es die Atomkraft-Debatte ist, die Sage vom Rattenfänger von Hameln oder das mangelnde Verständnis der Elterngeneration, was die Bedeutung virtueller Netzwerke betrifft („Blogs oder so was.“) – alles muss rein, aber kaum etwas davon kommt je über das Stadium der flüchtigen Anspielung hinaus. Dieses Spielfilm-Debüt erweist sich leider als ideales Beispiel dafür, dass gute inhaltliche Ideen vollkommen untergehen können, wenn die künstlerische Umsetzung sie nicht zu tragen vermag.

Einen zweiten großen Schwachpunkt bildet die Art der Informationsvermittlung. Speckenbach bringt die Dinge viel zu sehr auf den Punkt – für einen Nachrichtenautor mag das gut sein, als Regisseur eines fiktiven Stoffs schnürt er Plot und Figuren damit die Atemluft ab. Nach fast jedem Schnitt wird in der nächsten Szene sofort (und oft recht ungeschickt) die entscheidende Information präsentiert – nichts darf sich organisch aus einer Situation entwickeln. Kaum sehen wir Lothar trübselig in einer nahezu leeren Bar sitzen, da wird er auch schon gefragt, was ihn denn hierhin verschlage. Und noch die klarsten Bildaussagen werden wörtlich in Sprache übersetzt. So hockt Lothars Frau verzweifelt am Tisch, nachdem ihre Tochter verschwunden ist, muss den offensichtlichen Inhalt des Motivs aber noch aussprechen: „Hätte ich doch nur besser aufgepasst!“

Manche Szenen verlieren durch ihre plumpe Inszenierung jegliche Glaubwürdigkeit – so zum Beispiel, wenn Lothar aus dem Nichts heraus ein fremdes Mädchen kidnappt und dessen Freunde lediglich zuschauen. Andere Szenen geraten allzu funktional: Einmal stiehlt Lothar einen Döner, weshalb der Verkäufer hinter ihm herrennt. Diese kurze Verfolgungsjagd hat jedoch keinen eigenen Wert innerhalb der Geschichte, sondern dient ausschließlich dazu, den Vater „zufällig“ in eine geisterhaft leere Schule stolpern zu lassen. Und wenn die Regie den Protagonisten demonstrativ vor eine Glasscheibe platziert, hinter der eine wilde Horde Kinder spielt, wird die Einstellung so lange beibehalten, bis auch der letzte Zuschauer das Fenster als Trennwand verstanden hat. Auch sonst zeigt sich der Film verkrampft um eine symbolische Ebene bemüht – so werden immer wieder Vögel eingeblendet, die mal als Vorboten des Schicksals, mal als Repräsentation der uneinfangbar entflogenen Kinder fungieren.

Dieser unbedingte Kunstwille erweist sich als selbst errichteter Stolperstein. Speckenbach verwechselt Fragmenthaftigkeit mit kunstvollem Erzählen: Obwohl das Drehbuch vieles überbetont und unnötig ausbuchstabiert, erfahren wir von der eigentlichen Geschichte erstaunlich wenig. Die schauspielerischen Leistungen sind von zwei Extremen geprägt – einerseits der gestisch übertriebenen Darstellung, andererseits einer hölzern-ausdruckslosen Performance. Zwei Schauspielerinnen tauchen irgendwann gar nicht mehr auf, da das Drehbuch ihre Figuren schlichtweg „vergisst“. Der visuelle Reduktionismus des Films ist durchaus beabsichtigt, führt jedoch zu einem Mangel an markanten Bildern, der gerade angesichts thematisch ähnlicher Werke erstaunt (Das Dorf der Verdammten, Village of the Damned, 1960; Ein Kind zu töten, ¿Quién puede matar a un niño?, 1976; Das weiße Band – Eine deutsche Kindergeschichte, 2009) und Die Vermissten insgesamt wie einen durchschnittlichen Fernsehfilm wirken lässt.
Neue Kritiken

After the Hunt

Die toten Frauen

The Mastermind

Tron: Ares
Trailer zu „Die Vermissten“

Trailer ansehen (1)
Bilder




zur Galerie (6 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.