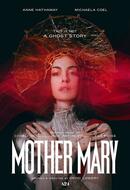Die Frau des Polizisten – Kritik
Den Miniaturen ein Monument errichten: Philip Gröning setzt die innere Uhr auf Null, immer wieder. Im Mittelpunkt Sprengsel eines Familienlebens ohne Kausalitäten.

Das zeitbasierte Medium Film hasst nichts so sehr wie die Unterbrechung. Wenn der Flow ins Stocken gerät, merken wir erst, wie ausgeliefert wir den Rhythmen der Bilder sind. Und wie sehr wir dies genießen. Unseren Atem anzuschmiegen an das Tempo des Schnitts und die Weite der Einstellungen. In der Totale einatmen, in der Großaufnahme innehalten, mit dem Schwarzbild langsam die Anspannung loslassen. Die Frau des Polizisten ist ein biorhythmisches Experiment, bestehend aus Momentaufnahmen, atmosphärischen Kapseln, kleinen in sich geschlossenen Geschichten. Mutter, Vater, Kind. Wie sie sich aufeinander beziehen, sich berühren, im Licht des Anderen leben, füreinander da sind. Wie das Miteinander scheitert. Wie die Zärtlichkeit den Ton angibt. Im nächsten Kapitel der unendliche, unbeschreibbare Schmerz. Ein waches Kameraauge erfasst alle Regungen, steuert den Blick auf die blauen Flecke. Der Polizist Uwe (David Zimmerschied) schlägt seine Frau Christine (Alexandra Finder).
Der Tragödie geht kein Drama voraus

Von 59 Kapiteln sind es nur eine Handvoll, in denen sich die Gewalt Bahn bricht, doch wenn sie erst einmal im Raum steht, sehen wir ihre Spuren überall. Es ist eine befremdliche Entscheidung, die Philip Gröning getroffen hat, Die Frau des Polizisten in so viele, behäbig voneinander getrennte Abschnitte zu unterteilen. Doch sie wirkt. Es tun sich Gräben auf, die zu überqueren eine Herausforderung ist. Genau deswegen schützen sie die vielfältigen Miniaturen vor der Übermannung durch den Stoff. So sehr die Gewalt auch ihre Fittiche ausbreitet, das einzelne Fragment widersteht der Versuchung, sich dem Thema unterzuordnen. Die Selbständigkeit des Augenblicks, der konkreten Erfahrung, löst die Kapitel heraus aus dem Zwang einer übergeordneten filmischen Funktion.

Recht früh im Film sitzt Uwe mit einer Kollegin im Polizeiwagen, die Nacht auf der Landstraße ist pechschwarz, nur das kreisende Blaulicht erhellt die Szene. Zwei Nachtarbeiter bei der lethargischen Verrichtung ihres Jobs. Die Zentrale über Funk kann zur späten Stunde nicht helfen, am Telefon ist auch der Förster nicht zu erreichen. Dann macht es Uwe eben selbst. Die Unfallfahrer bittet er mit Nonchalance zur Seite, beugt sich zum blutenden, aber noch lebenden Wild hinunter und drückt ab. Ein paar Augenblicke wartet er, bis das Leben aus dem Tier entwichen ist, dann zieht er es auf die andere Straßenseite und hinein in die Grube, markiert mit großen, langsamen Kreidestrichen auf dem Asphalt die Stelle, wo der Leichnam nun liegt. Es ist eine von ganz wenigen Sequenzen, die den Polizisten bei der Arbeit zeigen, und der Regisseur inszeniert sie zugleich unspektakulär und hinreißend düster. Die Stille nach dem Schuss. Gröning und seiner Co-Autorin Carola Diekmann reicht die sichtbar sich ausbreitende Materie einer genügsamen, aber nie befriedigenden Existenz, um die Misere des angeblich erfüllten Provinzlebens für einen wie Uwe zu transportieren. Der Tragödie geht kein Drama voraus.
Nicht die Wirklichkeit, sondern eine Parallelwelt

Das Experimentelle von Die Frau des Polizisten spiegelt sich auch in einer Vielzahl an Kapiteln, die in einem Augenblick austauschbar, im nächsten unverzichtbar erscheinen. Immer wieder sehen wir Mutter und Tochter zusammen, die kleine Clara (Pia und Chiara Kleemann) wird eingeführt in die Welt, mit fantasievollen, erklärenden, vorsichtigen Versuchen der korrekten Erziehung. Kacheln werden im engen Hof abgelöst, damit sie etwas pflanzen kann. Christine erhält die Illusion eines versteckten Tieres im Wandloch, indem sie die hineingelegten Snacks wieder entnimmt, sobald die Tochter abgelenkt ist. Und sie erhält die Illusion einer funktionierenden Familie. Die beiden gehen spazieren. Sie baden. Singen. Als wären sie nicht gefangen in ihrem familiären Zusammensein mit dem Vater. Gröning reiht Moment an Moment, keiner ist identisch mit dem anderen, alles liegt in den Nuancen, auch in scheinbaren Wiederholungen.

Wie zum Beleg erlaubt sich der Regisseur eine bemerkenswerte formale Bandbreite: von Überwachungsbildern aus der Vogelperspektive über eine dynamische Handkamera bis hin zu gesetzten Aufnahmen aus vermeintlich objektiver Warte. Die verschiedenen Stile beherrscht Philip Gröning mühelos. Trotz der häufigen Wechsel von Tonalität, Perspektive und Intensität, kein Bruch. Als ein für seine Improvisationsarbeit bekannter Regisseur liegt ihm die Schauspielführung augenscheinlich wie nichts anderes. Das naturalistische Spiel der beiden Hauptdarsteller ist verblüffend. Obwohl Die Frau des Polizisten an nichts weniger gelegen sein könnte als an der Illusion von Wirklichkeit, führen uns die in aller Komplexität aufeinander wirkenden Protagonisten hinein in eine Parallelwelt, in viele Orte, multiple Persönlichkeiten, verschiedenste Situationen, von der jeder und jede einzelne da ist. Dieses Dasein ist unverrückbar, weil es mich direkt und unmissverständlich angeht. Weil das richtig eingesetzte Fragment ein Splitter ist, der sich festsetzt.
Neue Kritiken

Gavagai

Stille Beobachter

Im Rosengarten

Die endlose Nacht
Trailer zu „Die Frau des Polizisten“


Trailer ansehen (2)
Bilder




zur Galerie (9 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.