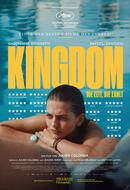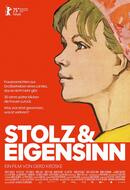Das Versprechen – Erste Liebe Lebenslänglich – Kritik
Für einen Doppelmord sitzt der Deutsche Jens Söring seit 1990 im US-Gefängnis. Ein filmisches Plädoyer bereitet nun die Indizien mit viel Gerichtssaal-Pathos auf. Für einen Freispruch ist den Regisseuren fast jedes Mittel recht.

Jens Söring trägt ein blaues Hemd: zu groß geschnitten für seine schmalen Schultern, genormt für eine Durchschnitts-Körpergröße, die Sörings Körper nicht ausfüllt. Zu dem Hemd trägt er eine Jeans, die sich mit einem Clip-Gürtel an seine Taille klammert, und eine Digitaluhr, die an der Mitte seines Unterarms Halt gefunden hat. Seit 30 Jahren lebt er in diesen Klamotten, der Uniform des Buckingham Correctional Center, einer Justizvollzugsanstalt in Virginia. Einzig die dicken Gläser von Sörings Hornbrille geben dem bis auf die Lippen ausgeblichenen Gesicht noch einen kleinen Farbanstrich. Noch bevor das Interview beginnt, zu dem er den Filmemachern und zwei gelangweilten Justizbeamten gegenübertritt, ist die Frage gestellt: Ist dieser Mann fähig, einen Doppelmord zu begehen?
Gemachter Mörder

Mit dieser Ausgangsfrage ordnet sich Das Versprechen in die Reihe der True-Crime-Dokumentarformate ein, die zuletzt mit den Mini-Serien The Jinx (2015) und Making a Murderer (2015) eine neue Blütezeit erlebte. Die HBO- und Netflix-Produktionen nehmen eine Sonderstellung ein, da sie Verbrechen zum Subjekt haben, dessen Beteiligte noch in Haft sitzen oder in noch laufende Verfahren verstrickt sind. Das gilt auch für Das Versprechen, für den Marcus Vetter und Karin Steinberger allerdings das Spielfilmformat als Schablone der True-Crime-Reportage wählen. Im Zentrum stehen dabei zwei Gerichtsprozesse, die für Jens Söring und seine ehemalige Freundin Elizabeth Haysom in lebenslangen Haftstrafen endeten.
Als junger College-Stipendiat, gerade 18 Jahre alt, lernt Söring Elizabeth kennen. Sie ist seine erste große Liebe und zugleich seine erste wirkliche Berührung mit einer Welt jenseits der behüteten Jugend. Elizabeths Eltern, die sie seit jungen Jahren sexuell missbrauchten, werden 1985 ermordet. Söring nimmt die Schuld auf sich, er gesteht den Mord, für den er später Elizabeth und einem unbekannten Mittäter verantwortlich macht.
Für sein ursprüngliches Geständnis geht er für mehr als 30 Jahre in ein amerikanisches Gefängnis. Da sich das Paar zum Zeitpunkt der Festnahme in London befindet, rettet die zur Auslieferung aufgestellte Bedingung, von der Todesstrafe abzusehen, Sörings Leben. Elizabeth teilt sein Schicksal und wird der Beihilfe zum Mord für schuldig befunden. Beide sitzen seitdem lebenslange Haftstrafen ab.
Filmemachen im Anwaltssessel

Mit dem Schuldspruch ist der Film auch bei seinem Herzstück angekommen. Es geht nicht um die Conditio humana, es geht um Schuld und Gerechtigkeit. Kurz gesagt: Die Filmemacher erklären Jens Söring für nicht schuldig. Der Unschuldsvermutung des Films werden alle weiteren Elemente untergeordnet. Vetter und Steinberger treten als nachgerichtliche PR-Anwälte auf. Indizien, Beweise und psychologische Profile werden im Sinne der Verteidigung präsentiert. Der Zuschauer hört von unzulässigen Experten, verschwundenen Beweismitteln, befangenen Richtern oder ganz allgemein dem „kaputten System“ von Virginias Politik.
In der Aufarbeitung dieser Vorwürfe hängen sich die Filmemacher an Sörings Lager. Privatdetektiv, Anwältin, Freund der Familie und ehemaliger Ermittler sind die Autoritäten, die neben Söring selbst zu Wort kommen. Einen Dokumentarfilm als Instrument der Gerechtigkeit ins Kino zu bringen ist ein fragwürdiger Ansatz. Wo Filmemacher wie Errol Morris und Joshua Oppenheimer Fragen stellen und Zweifel zum Teil ihrer Erzählung machen, fungieren Vetter und Steinberger nur als Wiederkäuer der Unschuldsindizien, die der „Freundeskreis Jens Söring“ seit Jahren vorlegt. Das Versprechen folgt einer Agenda, deren Ausrichtung nur eine Form der Beweisaufnahme zulässt. Die filmische Arbeit besteht zum Großteil aus der Neu-Organisation von Archivmaterial und Interviewaufnahmen. Die verwaschene VHS-Optik beherrscht große Teile eines Films, der sich – der Aktualität seines Sujets zum Trotz – anfühlt wie eine bereits hundertfach abgespielte Kassette.
Indizien mit Sahnehäubchen

Das Versprechen verschreibt sich voll und ganz dem dramatischen Pathos des amerikanischen Gerichtssaals. Das macht den Film über weite Strecken der zweistündigen Laufzeit durchaus kurzweilig. Die Informationsdichte verkettet er dicht in seine Dramaturgie. Wo sich Klärungsbedarf ergibt, springen Talking Heads ein. Das Plädoyer, das Vetter und Steinberger als Stellvertreter der Söring-Verteidigung halten, ist durchaus straff vorgetragen und mitunter überzeugend. Sobald der Film dabei das Terrain der Justizreportage verlässt, wird er gänzlich zum abgeschmackten Freispruchplädoyer, mit veredeltem Archivmaterial. Dazu säuseln Imogen Poots und Daniel Brühl mit ihren Stimmen die Briefwechsel vor, den Haysom und Söring zu Liebeszeiten führten. Über ihre Stimmen legen sich Bilder von den Leichen der Mordopfer, die zusätzlich von einer Aussage aus der Gerichtsverhandlung und trauervoller Musik garniert werden.
Unberührt von der Gerichtssaal-Solidarität und deren Pathos-Garnitur bleiben nur die Beamten, die Söring beim Interview gegenübersitzen. Mit überwältigendem Gleichmut heftet sich ihr Blick an den Gefangenen und dessen übergroße Gefängnisklamotten. Frei von Verständnis, Mitleid oder Urteil bleibt ihr apathisches Starren das größte Faszinosum des Films.
Neue Kritiken

Leibniz – Chronik eines verschollenen Bildes

Kung Fu in Rome

Dangerous Animals

Versailles
Trailer zu „Das Versprechen – Erste Liebe Lebenslänglich“

Trailer ansehen (1)
Bilder




zur Galerie (18 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.