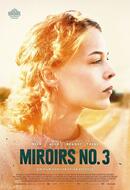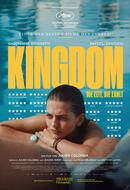The Whispering Star – Kritik
Ein Haus, das durch den Kosmos fliegt; eine Postbotin, die durch die entleerten Landschaften Fukushimas wandert. Sion Sono hat einen ziemlich langsamen Film gedreht.

Yoko Suzuki (Megumi Kagurazaka) niest immerzu, beachtlich für einen batteriebetriebenen Androiden. Und einmal, da kitzelt sie den Bordcomputer, der für den reibungslosen Betrieb ihres Raumschiffs zuständig ist, mit dem Yoko durch die Galaxie reist, und der Bordcomputer kriegt sich nicht mehr ein. Es sind dies eigentlich die einzigen klassisch menschlichen Affekte eines Films, der ansonsten eher denkt, und das ziemlich laut: über Maschinen, über Computer, über den Menschen. Den Menschen und seine Sehnsucht nach Zeit und Raum, so heißt es einmal, als wir gerade ein paar Hintergründe von Sion Sonos Science-Fiction-Saga The Whispering Star aufgetischt bekommen: den Menschen, der einst nach langem Vorlauf den Heimteleporter erfunden hat und den dann sofort eine große Melancholie überkam, weil Raum und Zeit auf einmal so gar keine Rolle mehr spielten.
Parodie des Minimalismus

Sono, ohnehin ein Filmemacher mit beachtlicher Output-Frequenz, zieht in letzter Zeit noch mal an – ganze vier Filme sind allein im Jahr 2015 fertig geworden, Tokyo Tribe lief erst kürzlich in den deutschen Kinos. The Whispering Star ist allerdings sehr anders, sehr viel langsamer als dieser letzte Film und auch die Werke, mit denen der Japaner bekannt geworden ist – vor allem Love Exposure (2008) und Guilty of Romance (2011). Aber man kann das natürlich auch anders deuten: Selbst zum Runterkommen braucht Sono das Filmemachen. Und so richtig kann er mit der Ruhe noch immer nichts anfangen. Zwar geht es ganz spartanisch los, mit einem tropfenden Wasserhahn, aber schon wie sich in diese ersten entrümpelten Einstellungen immer wieder Schriftzüge mit Wochentagen dazwischenschieben, während sich im Bild gar nichts ändert, mutet fast an wie eine augenzwinkernde Parodie auf filmischen Minimalismus und dessen Obsession für das reine Verstreichen von Zeit.
Die Dauer jedenfalls ist zwar ein zentrales Motiv dieses Films, wird uns aber nicht als Erfahrung aufgezwungen. Das wäre auch etwas schwierig. Yoko ist nämlich interstellare Postbotin in einem Universum, in dem die letzten Menschen nur noch etwa 20 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmachen und noch dazu verstreut auf den unterschiedlichsten Planeten wohnen. Zwei bis drei Jahre darf Yoko abweichen vom geplanten Liefertermin, ihr letztes Paket wird sie voraussichtlich in elf Jahren ausliefern. (Und dazu kommen Navigationsprobleme, denn die Optik des Bordcomputers scheint falsch ausgerichtet zu sein und die Fliegen in der Deckenlampe mit der Weltall-Umgebung zu verwechseln.) In den übergroßen Boxen stecken kleine, einfache Dinge mit wohl eher Nostalgie- als Gebrauchswert. Es ist wohl die Sehnsucht nach Zeit und Raum, derentwegen man hier Dinge verschickt, der Postdienst als eigentlich anachronistischer Retro-Chic.
Bescheidene Melancholie

Die Beschaffenheit der filmischen Welt hängt wohl auch mit der Entstehungsgeschichte von The Whispering Star zusammen – und die wiederum hat weniger mit Brainstorming und Drehbuchfassungen zu tun als mit dem Setting. Sono hat seinen Film nämlich in Fukushima gedreht; wenn Yoko mit ihrem Raumschiff einmal landet, dann läuft sie durch Geisterstädte, durch verlassene Häuser, durch entleerte Räume, in denen hie und da mal noch jemand lebt oder gar einen Strandkiosk betreibt. Diese Welt ist also weniger Science-Fiction als eine ins Universum gedehnte und in die Zukunft projizierte real-postapokalyptische. Im einsam durchs Weltall treibenden Raumschiff – das von außen wie ein gemütliches Häuschen aussieht – wie auf Yokos Ausflügen an Land zieht sich eine Melancholie durch den Film, die aber trotz des aufgeladenen Settings keinesfalls große Bedeutsamkeit behauptet. Dafür ist The Whispering Star viel zu bescheiden angelegt.
Leichte Schwermut

Das zeigt sich auch im Umgang mit den Vorbildern, denn beim sprechenden Computer mit Hang zum Fehler, bei den öden Landschaften, auf denen in die Gegend verstreute Existenzen umhertreiben, ist man natürlich schnell bei Kubrick und Tarkowski. Aber eben eher beiläufig und spielerisch. Der Computerfehler ist kein größeres Problem, die Existenzen sind nicht existenziell verloren, sondern höchstens von allen guten Geistern verlassen. Die Schwermut kommt eher leicht daher. Was auch damit zu tun hat, dass Sono jeder plumpe Kulturpessimismus abgeht. Die Nostalgie von The Whispering Star bezieht sich auf kein verlorenes Paradies oder menschliche Unschuld, höchstens auf das erschwerte Überleben menschlicher Idiosynkrasien. Es ist nicht das Natürliche, das zerstört wird durch die Macht der Maschinen, sondern das Unreine, das Schiefe, das Eigene, um das es schade wäre, wenn der Mensch ausstirbt. Und in diese Art von Menschlichkeit schließt Sono auch die Klone ein, wenn sie vom eigenen Niesen überrascht sind, und auch die Maschinen, wenn sie sich kitzeln lassen.
Konsequent und schön also, dass das potenziell affirmativste Bild des Films – wenn Yoko nämlich auf dem letzten Planeten landet, der ausschließlich von Menschen bewohnt wird – zugleich das abstrakteste ist: Das Menschliche ist hier in kein Gesicht und kein Gefühl gelegt, sondern in die Schatten von einigen Gestalten hinter einer weißen Wand; Silhouetten, die beim Abendbrot sitzen, Zeitung lesen, an ihrem Fahrrad schrauben. Ein Panorama, das anrührt, gerade weil es so anonym ist.
Neue Kritiken

Miroirs No. 3

Leibniz – Chronik eines verschollenen Bildes

Kung Fu in Rome

Dangerous Animals
Trailer zu „The Whispering Star“

Trailer ansehen (1)
Bilder




zur Galerie (6 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.